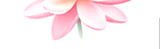
|

Heilpflanze des Monats Dezember
Spitzwegerich (Plantago lanceolata)
Der Spitzwegerich
Regen, Wind, Schnee und klirrende Kälte - die Jahreszeit bringt
nicht nur den Weihnachtsmann, das Christkind und jede Menge Geschenke.
Wenn das Tageslicht bereits am Nachmittag verschwindet und die Temperaturen
sinken, fängt der Hals an zu kratzen, die Nase zu laufen und
macht einem der Husten zu schaffen.
Hilfe gegen Husten und Erkältung
Ein altes und sehr wirksames Mittel gegen Atemwegserkrankungen ist
seit je her der Spitzwegerich.
Dank seiner sehr günstigen Wirkstoff- Kombination ist das Kraut
ein gutes Hustenmittel. Zusätzlich bietet die Pflanze gute Fähigkeiten
bei der Wundheilung.
Zuhause in aller Welt
Der Spitzwegerich findet man typischerweise an Wegrändern, Äckern
und auf trockenen Wiesen auf der ganzen Welt. Im Gegensatz zu so mancher
seiner Heilpflanzen-Kollegen, kommt der Spitzwegerich in freier Wildbahn
häufig vor und ist deshalb auch nicht gefährdet. Hauptlieferländer
sind Ost-Länder wie Ungarn, Bulgarien, Rumänien, Tschechien,
Polen und Russland.
Der Anbau der Pflanze ist eher unbedeutend. Auf kleinen Flächen
in Deutschland, Tschechien, Frankreich und Belgien wird Spitzwegerich
kultiviert.
Auch im eigenen Garten ist Spitzwegerich recht einfach anzupflanzen.
Er stellt wahrlich keine hohen Ansprüche. Jedoch vermehrt sich
diese Pflanze auch gerne ungewollt. Dies einfach frühzeitig unterbinden.
Medizinisch verwendet werden die zur Blütezeit gesammelten oberirdischen
Pflanzenteile.
Name - König der Strasse
Das Wort Wegerich stammt ursprünglich aus dem Althochdeutschen.
Es setzt sich aus den Teilen "wega" (= Weg) und "rih"
(= König) zusammen. Der deutsche Name kann also ungefähr
mit "Wegbeherrscher" übersetzt werden. Wie so viele
Namensursprünge deutet dieser wohl auf den Standort hin.
Synonyme
Heilwegerich, Wundwegerich, Aderblatt, Aderkraut, Heilblärer,
Heufressa, Hundsrippen, Lägenblatt, Lämmerzunge, Lügenblatt,
Lungenblattl, Rippenkraut, Ripplichrut, Rossrippen, Rossrippe, Schafzunge,
Schlangenzunge, Siebenrippe, Spiesskraut, Spitzfederich, Spitz-Wegeblatt,
Wagentranenblatt, Wegbreite, Wegreich, Wegtritt, Wegetritt
Heilwirkung - Reizlinderung
Die Wirkung des Spitzwegerich ist wissenschaftlich belegt. Der Spitzwegerich
wirkt in erster Linie entzündungshemmend, schleimlösend,
antibakteriell, blutreinigend, blutstillend und harntreibend.
Spitzwegerichkraut enthält vor allem Schleimstoffe, das Glykosid
Aucubin (Rhinanthin), Gerbstoffe und Kieselsäure. Die Schleimstoffe
wirken reizmildernd bei Husten. Sie überziehen die Schleimhäute
der Atemwege sozusagen mit einer Schutzschicht, die Entzündungen
heilen und neue Virenangriffe abwehren. So kann auch der störende
Hustenreiz unterdrückt werden.
Aber auch das Antibiotikum Aucubin und die Gerbstoffe wirken sich
günstig auf die Schleimhäute aus, befreien befallene Areale
von Bakterien und stoppen Entzündungen. Aucubin ist zwar nicht
so stark wie Penicillin, wirkt bei Wunden, Bronchitis und bei Katarrhen
jedoch sehr gut. Die Kieselsäure stärkt hingegen das Bindegewebe
und sorgt indirekt für die Steigerung der Abwehr.
Dazu gehört der Spitzwegerich zu den Pflanzen, die beim Menschen
die Produktion von "Interferon" anregen. Dies erhöht
die Abwehrkräfte gegen Viren in den Luftwegen.
Diese Wirkstoffkombination macht den Spitzwegerich zu einem der besten
Hustenmittel.
Hauptanwendung - Husten
Die hauptsächliche Anwendung findet der Spitzwegerich als Hustenmittel.
D.h. innerlich zur Behandlung von entzündlichen Atemwegserkrankungen
(Erkältungen), bei Bronchitis, Asthma, Keuchhusten, Halsentzündung
und Halsschmerzen.
Für die innerliche Anwendung verwendet man meist Spitzwegerichtee
oder Teemischungen mit Spitzwegerich, Sirup oder Saft vom Spitzwegerich.
Diese lösen festsitzenden Schleim und lindern entzündliche
Prozesse.
Spitzwegerich zur Wundheilung
Äusserlich angewendet eignen sich auch Zubereitungen zur Behandlung
von entzündlichen Hauterkrankungen und allgemein bei Wunden.
Die enthaltenen Gerbstoffe wirken zusammenziehend. So ist der Einsatz
von Spitzwegerich auch bei Insektenstichen durchaus förderlich.
Dazu sollte man gleich nach dem Insektenstich frische, zerriebene
Blätter auf die betroffene Stelle legen.
Äusserlich wird er als Spülung, Bad oder Pinselung angewendet.
Tee, Saft oder Sirup? Blatt oder Blüte?
Die Aufbereitung der Spitzwegerich-Blätter erfolgt ganz unterschiedlich.
Der Spitzwegerich wird als Aufguss oder Tee verwendet. Ebenso verwendet
man den ausgepressten Saft der Blätter.
Üblicherweise werden frische Pflanzenteile verarbeitet. Dabei
werden nur junge Blätter geerntet, bevor die Blüte ansetzt.
Diese werden dicht an der Rosette abgeschnitten. Dabei sollten die
anderen Blätter oder die Wurzel nicht verletzt werden.
Dieser Saft ist lange haltbar. Dies ist höchstwahrscheinlich
dem antibiotisch wirkenden Aucubin zu verdanken. Am gängigsten
ist die Zubereitung eines Spitzwegerich-Tees.
Den Sirup stellt man aus Blättern und Blüten her. Hierzu
werden die Pflanzenteile zusammen mit Honig oder Zucker eingekocht.
Bloss nicht kochen!
Wichtig ist, dass die verarbeitete Pflanze für die innerliche
und äusserliche Verwendung richtig aufbereitet werden. Ansonsten
geht schnell die Wirkung der Inhaltsstoffe verloren.
Dies tritt z.B. bei zu starker Erhitzung (wie bei der Herstellung
eines Aufgusses oder gar einer Abkochung) ein. Auf biochemischer Ebene
wird das Beta-Glukosidase Enzym zerstört. Dadurch wird die Hydrolyse
des Aucubins verhindert und hat letztendlich ein solches Getränk
seine antibiotische Wirkung eingebüsst.
Geeignetere Aufbereitungen stellen heutzutage z.B. wässrige Kaltauszüge
dar.
Erste Hilfe in freier Natur
Wer sich in freier Natur verletzt, kann schnell Abhilfe schaffen.
Hat man keinen Erste-Hilfe-Kasten dabei, einfach einige Spitzwegerichblätter
zerkauen und auf die Wunde auflegen. Mit einem unzerkauten Blatt kann
das Ganze bedeckt werden.
Eine Alternative - Das Aufträufeln ausgepressten Saftes. Auf
Wespen- und Bienenstiche, Wunden, nässende Hautentzündungen
wirkt der Saft abschwellend und abheilend.
Hier hilft die blutgerinnungsfördernde, leicht antibakterielle,
zusammenziehende (adstringierende) und desinfizierende Wirkung der
Pflanze.
Zubereitung als Tee
Ca. 3 Gramm Kraut mit 150ml heissem Wasser übergiessen. Nach
10min absieben. Die Dosierung von 2- 3 Tassen je Tag nicht überschreiten.
2 Teelöffel (ca. 2 g) zerkleinerte Droge werden mit ca. 150 ml
Wasser kalt angesetzt, kurz aufgekocht und nach 10 Minuten abgeseiht.
Zubereitung als Saft
Reinigen Sie die Spitzwegerich-Blätter und pressen Sie aus Ihnen
den Saft heraus. Dazu können Sie auch einen Entsafter benutzen.
Tragen Sie den Saft auf die betroffenen Stellen auf.
Bitte beachten Sie
Alle auf dieser Webseite bereitgestellten Informationen stellen
in keiner Weise einen Ersatz für eine ärztliche Diagnose
oder eine Behandlung durch ausgebildete Ärzte und Mediziner
dar. Die Informationen dürfen nicht für die eigene
Therapieauswahl oder gar für eigene Diagnosen verwendet
werden. |
|
|

Aktuelles & News
Neues rund um Medizin und Gesundheit... weiter |
Heilpflanzen
Infos über die Heilwirkung von Pflanzen... weiter |
Tipps zur Gesundheit
Lesen Sie unsere aktuellen Gesundheitstipps... weiter |
Fragen & Antworten
Wir beantworten Fragen aus der Praxis... weiter |
Alternative Therapien
Hier stellen wir alternative Heilverfahren vor... weiter |
|
|


